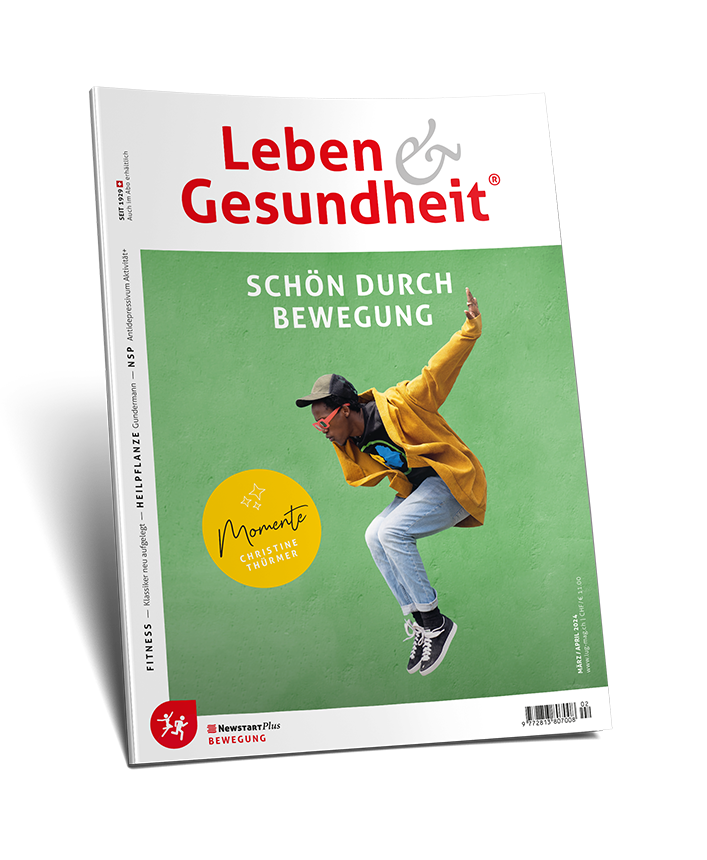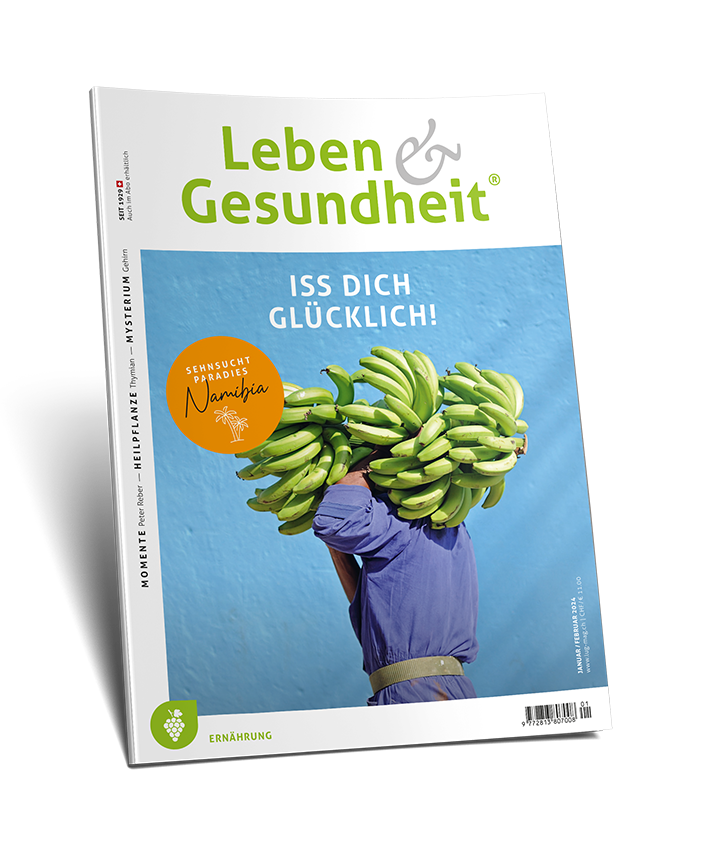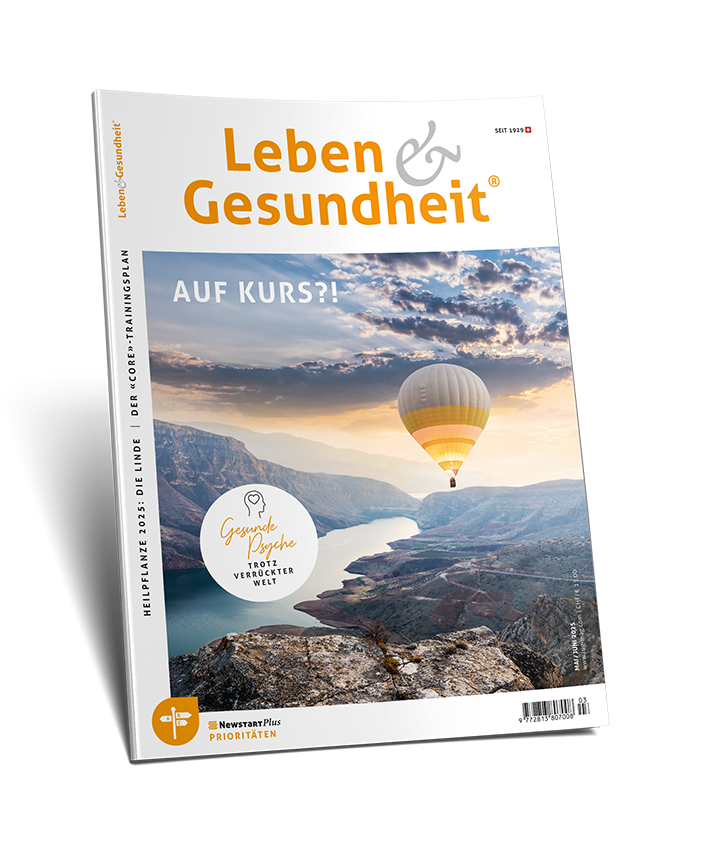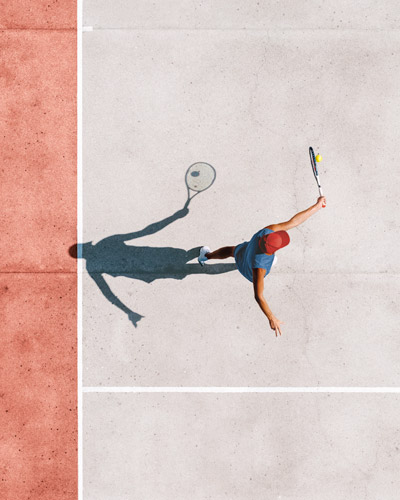Optimismus
Zu viel Nachdenken führt zu Grübelkeit
«Musste ich gleich so emotional reagieren? Warum passiert mir das ständig? Hätte ich bloß meinen Mund gehalten! …»
Dörthe Meisel
Dipl. Psychologin
Unser Gehirnkino ist immer aktiv – bewusst oder unbewusst. Es produziert ständig neue Filme, kramt in alten Erinnerungen oder spielt schon mal eine Vorabversion der kommenden Verabredung vor; Themen, die uns beschäftigen, tauchen besonders häufig auf. Eine Spielpause gibt es nicht.
Manche Filme tauchen scheinbar aus dem Nichts auf und verschwinden wieder. Andere werden wieder und wieder abgespielt mit minutiösen
Details einzelner Szenen und langen Monologen, mit kreisenden Fragen, die sich auch nach wochenlangem, sogar jahrelangem Nachdenken nicht beantworten lassen …
Dieses «Herumkauen» auf einem Problem zeigt, dass wir vom Weg des zielgerichteten Nachdenkens abgekommen sind und uns im Kreis drehen – ohne Ergebnis. Wir sind ungewollt ins Grübeln geraten! Wenn sie sich unsicher sind, ob Sie gerade lösungsorientiert nachdenken oder unkonstruktiv grübeln, kann die «Zwei-Minuten-Regel» (Addis & Martell, 2014) hilfreich sein (siehe Abb 1).
Ab wann wird es
problematisch?
Die Forschungsergebnisse der letzten drei Jahrzehnte zeigen, dass häufiges Grübeln negative Stimmungen verstärkt und aufrechterhält. Außerdem führt es zu einer Zunahme negativer Gedanken und Erinnerungen, vergangene Erfahrungen werden schlechter bewertet, Konzentrations- und Entscheidungsschwierigkeiten nehmen zu, es ist schwieriger, ins Handeln zu kommen, zwischenmenschliche Beziehungen werden belastet und es können dadurch auch psychische Störungen wie Depression oder soziale Ängste entstehen.
Da es keine klare Trennlinie zwischen unproblematischem Gelegenheitsgrübeln und krankhaftem Dauergrübeln gibt, entscheiden Sie selbst, wann Sie etwas unternehmen wollen. Hinweise, wie Ihr «Zu-viel-Denken» aussieht, erhalten Sie in der Abb. 2 «Persönliche Grübelneigung» (Ehring et al., 2011). Welche Aussagen treffen auf Sie zu?
Was veranlasst zum
Grübeln?
Bestimmte Situationen wie Krankheit, Umzug, eine neue Arbeitsstelle oder der Verlust einer nahestehenden Person können uns in unserer Sicherheit und sozialen Geborgenheit erschüttern. Das sind häufig Phasen des vermehrten Nachdenkens bis hin zum Grübeln als eine Strategie, um Wege der Bewältigung zu finden. Nach einiger Zeit werden wir uns vermutlich wieder wohler fühlen, weil wir inzwischen erste Kontakte am neuen Ort oder Arbeitsplatz geknüpft haben, weil wir trotz gesundheitlicher Einschränkungen Wege gefunden haben, unser Leben zu gestalten oder weil wir enger mit ähnlich betroffenen Personen zusammengerückt sind.
Schwierig wird es jedoch, wenn wir die Situation nicht bewältigen können und unsere Grundbedürfnisse längere Zeit nicht gestillt werden. Wir erleben eine deutliche
Diskrepanz zwischen dem, was wir brauchen, und dem, was die aktuelle Situation uns bietet. Damit bleiben unangenehme Gefühle bestehen.
Weiterlesen ...
Lesen Sie alle vollständigen Artikel in
der Printausgabe des Magazins Leben & Gesundheit.