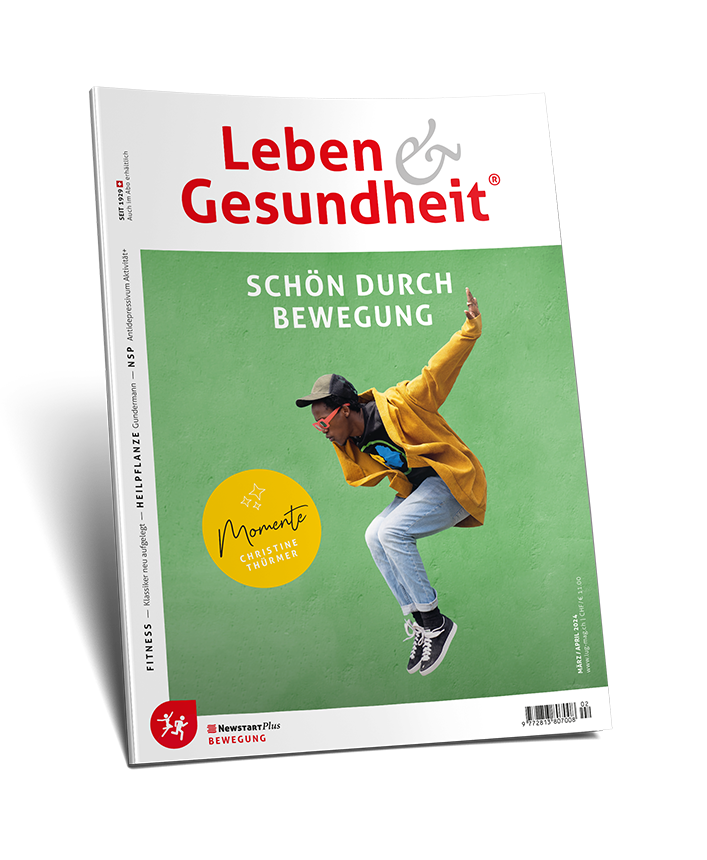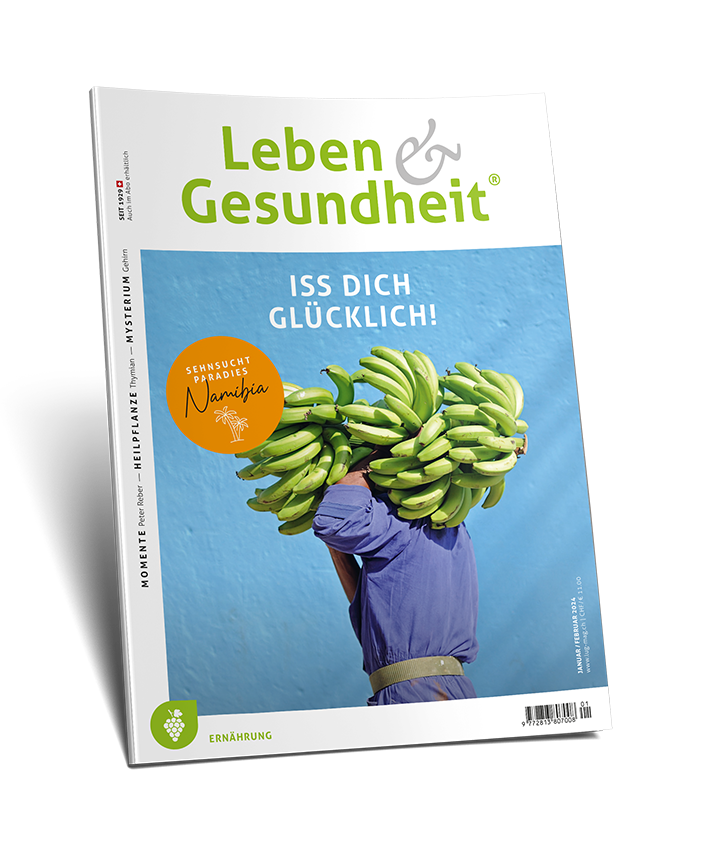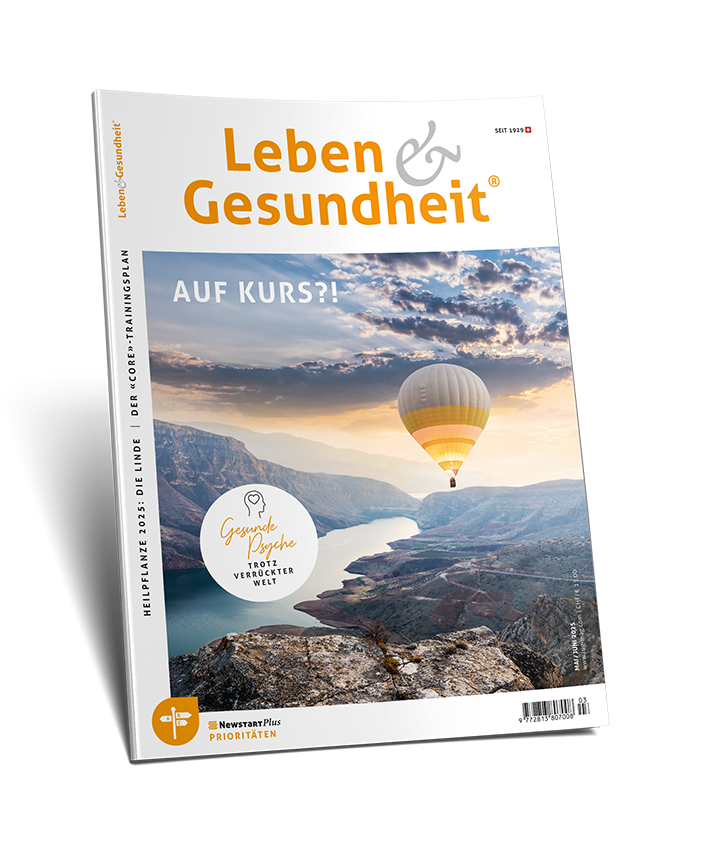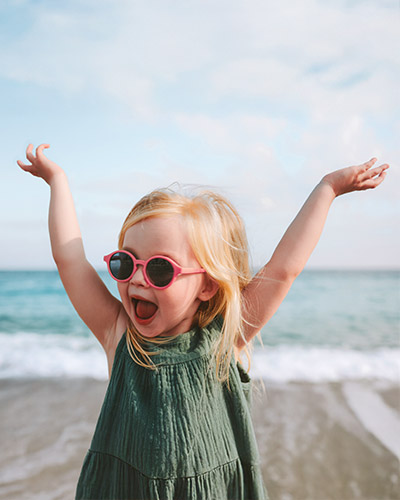Integrität
Die Macht der Gewohnheit – und wie sie sich verändern lässt
Das Erreichen persönlicher Integrität ist ein Ziel, das viele Menschen anstreben. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist die Fähigkeit, sich gute Gewohnheiten antrainieren und schlechte Gewohnheiten abbauen zu können.
Robbie Pfandl
Psychotherapeut
Dissonanz &
Dissonanzreduktion
Die Theorie der Dissonanzreduktion ist ein psychologisches Konzept, das von Leon Festinger in den 1950er-Jahren entwickelt wurde. Diese Theorie befasst sich mit der Art und Weise, wie Menschen mit kognitiven Dissonanzen umgehen – dem inneren Konflikt und der unangenehmen Spannung, die entsteht, wenn eine Person widersprüchliche Gedanken, Überzeugungen oder Verhaltensweisen hat.
Kognitive Dissonanz tritt auf, wenn Menschen Erfahrungen machen, die ihren bisherigen Überzeugungen oder Verhaltensweisen widersprechen. Beispielsweise kann jemand, der sich als umweltbewusst betrachtet, eine innere Spannung erleben, wenn er eine umweltschädliche Handlung ausführt. Diese Dissonanz führt zu einem unangenehmen Gefühl, das die betroffene Person dazu motiviert, die Spannung zu reduzieren und wieder ein inneres Gleichgewicht herzustellen.
Menschen nutzen verschiedene Strategien, um kognitive Dissonanzen zu reduzieren. Eine Person kann ihre Überzeugungen anpassen, um sie mit ihrem Verhalten in Einklang zu bringen. Oder sie kann ihr Verhalten ändern, um es mit ihren Überzeugungen in Einklang zu bringen. Letzteres ist einfacher gesagt als getan.
Die Crux mit
der Willenskraft
Selbstkontrolle ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen – bei der Arbeit, in der Schule oder in zwischenmenschlichen Beziehungen. Disziplinierte Menschen sind besser in der Lage, langfristige Ziele zu verfolgen und kurzfristigen Versuchungen zu widerstehen.
Willenskraft allein reicht oft nicht aus, um dauerhafte Veränderungen zu bewirken. Unsere täglichen Routinen sind größtenteils von unbewussten Handlungen geprägt, die durch bestimmte Auslöser aktiviert werden. Diese Gewohnheiten sind tief in unseren neuronalen Schaltkreisen verankert und werden durch Belohnungen verstärkt.
Die Willenskraft ist eine begrenzte Ressource, die im Laufe des Tages
erschöpft werden kann. Jede Entscheidung und Handlung, die Selbstkontrolle erfordert, verringert die verfügbare Willenskraft. Dadurch geben wir am Ende des Tages leichter Versuchungen nach oder neigen vermehrt dazu, unüberlegte Entscheidungen zu treffen.
Strategien zur Stärkung
der Willenskraft
Um die Willenskraft zu stärken, können folgende Strategien hilfreich sein:
Bewusste Planung:
Die Bedeutung der Planung
und Vorbereitung, um Versuchungen zu minimieren und die Entscheidungsfindung zu erleichtern.
Regelmäige Pausen:
Die Wichtigkeit von Pausen und Erholung, um die Willenskraft wieder aufzuladen.
Gesunde Gewohnheiten:
Der Aufbau von Routinen, die weniger Willenskraft erfordern und somit Energie für wichtigere Entscheidungen sparen.
Selbstbeobachtung:
Die Rolle der Selbstbeobachtung und Reflexion bei der Erkennung von Auslösern für ungewolltes Verhalten.
Die Rolle der Ernährung
und des Blutzuckerspiegels
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbindung zwischen Willenskraft und Ernährung. Ein stabiler Blutzuckerspiegel ist wesentlich für die Aufrechterhaltung der Selbstkontrolle. Ein niedriger Blutzuckerspiegel kann die Willenskraft schwächen und zu impulsivem Verhalten führen. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig nahrhafte und ausgewogene Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um die Willenskraft zu stabilisieren.
Die Bedeutung des
Selbstwertgefühls
Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl sind eher in der Lage, ihre Willenskraft effektiv einzusetzen und Rückschläge zu überwinden. Folgende Strategien können zur Stärkung des Selbstwertgefühls beitragen, um die Disziplin zu fördern und langfristigen Erfolg zu sichern:
Die Praxis der Selbstbestätigung:
Dies bedeutet, sich regelmäßig seine Stärken und Erfolge bewusst zu machen und diese auch zu feiern.
Die positive «Zukunftsvisualisierung»:
Dabei stellt man sich vor, wie man in der Zukunft bestimmte Ziele erreicht und wie man sich dabei fühlt.
Die Pflege von sozialen Beziehungen spielt eine wichtige Rolle:
Starke, unterstützende Netzwerke aus Freunden, Familie oder Kollegen können das Selbstwertgefühl erheblich fördern.
Die Praxis der Selbstfürsorge:
Kleine tägliche Handlungen der Selbstfürsorge, wie
ausreichend Schlaf, gesunde
Ernährung und regelmäßige Bewegung, tragen nicht nur zur physischen Gesundheit bei, sondern stärken auch das psychische Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl.
Was ist eine Gewohnheit?
Wenn eine Handlung in einem bestimmten Kontext wiederholt und belohnt wird, bildet sich eine neuronale Verbindung, die diese Handlung in eine Gewohnheit verwandelt. Diese Gewohnheiten werden tief in unserem Gehirn verankert und beeinflussen unser Verhalten, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Gewohnheiten verändern – ist das möglich?
Um negative Gewohnheiten zu ändern, müssen wir uns über den Einfluss von Umgebungsfaktoren auf unsere bewussten Entscheidungen klar werden. Wir sollten versuchen, die Umgebung so zu gestalten, dass positive Gewohnheiten gefördert und negative erschwert werden. Dies kann durch einfache Änderungen erreicht werden, wie zum
Beispiel das Platzieren von gesunden Snacks in Sichtweite oder das Entfernen von Ablenkungen am Arbeitsplatz.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Verständnis der automatischen Natur von Gewohnheiten. Anstatt sich auf Willenskraft zu verlassen, sollten wir Strategien entwickeln, um unsere Gewohnheiten gezielt zu steuern und zu lenken. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Identifikation von Auslösern, die oft mit bestimmten Emotionen, Zeiten des Tages oder sozialen Situationen verbunden sind.
Ebenfalls hilfreich ist die Rolle des Glaubens und der Gemeinschaft bei der Veränderung von Gewohnheiten. Es zeigt sich, dass Menschen erfolgreicher darin sind, ihre Gewohnheiten zu ändern, wenn sie an den Erfolg glauben und von einer unterstützenden Gemeinschaft umgeben sind. Dies wird durch Beispiele wie die Anonymen Alkoholiker deutlich, deren Programm stark auf Gemeinschaft und Glauben setzt.
Gewohnheitsbildung konkret
Damit wir eine Verhaltensänderung herbeiführen und daraus eine gute Gewohnheit bilden können, sind folgende Schritte hilfreich:
1. Schritt: Mach
es offensichtlich!
Beim ersten Schritt soll man seine Gewohnheiten offensichtlich machen. Dazu empfiehlt es sich, die Umgebung so zu gestalten, dass die gewünschten Gewohnheiten leicht erkannt und umgesetzt werden können. Dies kann durch visuelle Hinweise, wie das Platzieren eines Obstkorbs an einem gut sichtbaren Ort, erreicht werden.
2. Schritt: Mach es attraktiv!
Gewohnheiten müssen attraktiv sein, um beibehalten zu werden. Dabei kann es hilfreich sein, positive Assoziationen mit den gewünschten Gewohnheiten zu schaffen und sie mit Belohnungen zu verknüpfen. Dies kann durch das Kombinieren von Aufgaben, die man gerne erledigt, mit solchen, die man weniger gerne macht, erreicht werden.
3. Schritt: Mach es einfach!
Gewohnheiten sollten einfach sein. Dazu ist es empfehlenswert, die Hürden für die Umsetzung der Gewohnheiten so niedrig wie möglich zu halten und kleine, machbare Schritte zu wählen. Dies kann durch das Vorbereiten von Mahlzeiten im Voraus oder das Bereitlegen der Sportkleidung am Vorabend erreicht werden.
4. Schritt: Mach es befriedigend!
Gewohnheiten müssen befriedigend sein, um langfristig aufrechterhalten zu werden. Dabei ist es wichtig, sich für erreichte Fortschritte zu belohnen und die positiven Auswirkungen der neuen Gewohnheiten zu erkennen. Dies kann durch das Führen eines Erfolgstagebuchs oder das Feiern von Meilensteinen erreicht werden.
Zusammenfassung
Um gute Gewohnheiten zu fördern und schlechte Gewohnheiten zu verringern, empfiehlt es sich, bewusst Änderungen in der Umgebung vorzunehmen. Ein praktisches Beispiel ist das Entfernen von Versuchungen aus dem Sichtfeld und das Platzieren von positiven Anreizen an sichtbaren Stellen. Indem man die Auslöser für das eigene Verhalten identifiziert und die Routinen anpasst, lässt sich die Belohnung für gute Gewohnheiten verstärken und die von schlechten Gewohnheiten minimieren. Dabei soll man sich zunächst auf kleine, leicht erreichbare Ziele konzentrieren, um die Selbstkontrolle zu stärken und schrittweise größere Veränderungen zu ermöglichen. Zudem spielen unsere sozialen Beziehungen eine wesentliche Rolle bei der Veränderung unserer Gewohnheiten – zum Positiven wie auch zum Negativen.
In der Gesamtschau besteht bei jedem von uns die Möglichkeit, unsere Integrität zu stärken. Wir haben es in der Hand, ob wir gute Gewohnheiten bilden und schlechte Gewohnheiten abbauen wollen oder nicht. Merke: Gut Ding will Weile haben!
Weiterlesen ...
Lesen Sie alle vollständigen Artikel in
der Printausgabe des Magazins Leben & Gesundheit.